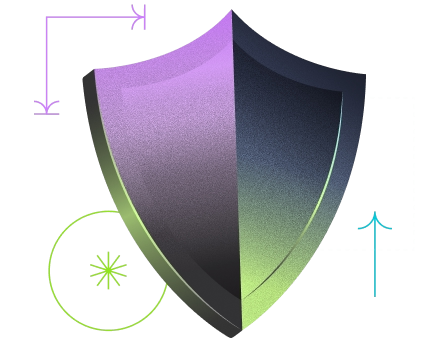Das deutsche Arbeitsrecht regelt die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und schafft einen verbindlichen Rahmen für faire Arbeitsbedingungen. Als Arbeitgeber in Deutschland müssen Sie zahlreiche gesetzliche Bestimmungen beachten, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und ein vertrauensvolles Arbeitsklima zu schaffen. Verstöße gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen können nicht nur kostspielige Gerichtsverfahren zur Folge haben, sondern auch das Unternehmensimage nachhaltig schädigen.
Das am 29. Oktober 2024 verkündete Bürokratieentlastungsgesetz IV, das zum 1. Januar 2025 in Kraft tritt, hat die Digitalisierung von HR-Prozessen vorangetrieben, indem es vollständig digitale Arbeitsverträge mit qualifizierter elektronischer Signatur ermöglicht.
Dieser umfassende Ratgeber erklärt Ihnen die wichtigsten Grundlagen des deutschen Arbeitsrechts, von der Vertragsgestaltung über Krankheitspflichten bis zur rechtssicheren Kündigung, und gibt praktische Hilfestellungen für den Arbeitsalltag.
Zusammenfassung auf einen Blick:
- Definition: Das Arbeitsrecht regelt Rechte und Pflichten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Deutschland und basiert auf Individual- und Kollektivarbeitsrecht
- Gesetzliche Grundlagen: Zentrale Gesetze sind das BGB, KSchG, ArbZG, BUrlG, EntgFG sowie EU-Richtlinien und Tarifverträge – das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlicht regelmäßig aktualisierte Leitfäden
- Arbeitgeberpflichten: Fürsorgepflicht, Gleichbehandlung, Arbeitsschutz, pünktliche Lohnzahlung und Einhaltung von Arbeitszeitsregelungen sind verpflichtend
- Krankheitsfall-Regelungen: Lohnfortzahlung für 6 Wochen gemäß § 3 EntgFG, anschließend Krankengeld nach § 44 SGB V, Kündigungsschutz während Arbeitsunfähigkeit
- Kündigungsschutz: Ab 6 Monaten Betriebszugehörigkeit und bei über 10 Beschäftigten greift das Kündigungsschutzgesetz mit besonderen Anforderungen
Definition und Grundprinzipien des Arbeitsrechts
Das deutsche Arbeitsrecht ist ein Teilgebiet des Privatrechts, das die rechtlichen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern regelt. Es umfasst sowohl die vertraglichen Vereinbarungen als auch die gesetzlichen Mindeststandards, die zwingend einzuhalten sind.
Die Besonderheit des deutschen Arbeitsrechts liegt in seinem Schutzcharakter: Es soll die schwächere Position des Arbeitnehmers ausgleichen und faire Arbeitsbedingungen gewährleisten. Gleichzeitig berücksichtigt es die berechtigten Interessen der Arbeitgeber an wirtschaftlicher Flexibilität und Planbarkeit.
Beispiel aus der Praxis: Ein kleines IT-Unternehmen mit 8 Mitarbeitern unterliegt anderen Kündigungsschutzbestimmungen als ein Industriebetrieb mit 200 Beschäftigten. Während das kleinere Unternehmen flexibler kündigen kann, müssen größere Betriebe strenge Sozialauswahlkriterien beachten.
Die zwei Säulen des deutschen Arbeitsrechts
Das Arbeitsrecht gliedert sich in zwei wesentliche Bereiche:
- Individualarbeitsrecht regelt die direkten Beziehungen zwischen einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Hierzu gehören Arbeitsverträge, Kündigungen, Arbeitszeit, Urlaubsansprüche und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
- Kollektivarbeitsrecht behandelt die Beziehungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie die Mitbestimmung durch Betriebsräte. Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und Streikrecht fallen in diesen Bereich.
Wichtig:
Nach § 3 Abs. 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EntgFG) haben Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bis zur Dauer von sechs Wochen. Diese Regelung bildet einen der zentralen Pfeiler des deutschen Arbeitsrechts.
Gesetzliche Rahmenbedingungen: Übersicht für Arbeitgeber
Individualarbeitsrecht vs. Kollektivarbeitsrecht
Als Arbeitgeber müssen Sie zwischen den verschiedenen Rechtsquellen unterscheiden und deren Rangfolge beachten:
- EU-Recht steht an oberster Stelle (z.B. DSGVO, Arbeitszeitrichtlinie)
- Bundesgesetze wie BGB, KSchG, ArbZG, EntgFG
- Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen (günstigere Regelungen möglich)
- Arbeitsverträge (dürfen nicht schlechter sein als übergeordnetes Recht)
Wichtige Gesetze und Verordnungen
Die zentralen Rechtsgrundlagen für Arbeitgeber sind:
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - enthält die grundlegenden Regelungen zum Arbeitsvertrag (§§ 611-630)
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG) - regelt den Schutz vor ungerechtfertigten Kündigungen
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG) - bestimmt maximale Arbeitszeiten, Pausenregelungen und Ruhezeiten
- Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) - regelt die Lohnfortzahlung im Krankheits- und Feiertagsfall
- Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) - garantiert Mindestansprüche auf bezahlten Jahresurlaub (24 Werktage)
- Nachweisgesetz (NachwG) - seit 2022 verschärfte Dokumentationspflichten für Arbeitsverträge
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlicht regelmäßig aktualisierte Leitfäden und Informationen zu allen Aspekten des Arbeitsrechts. Diese Ressourcen sind besonders hilfreich bei der Interpretation komplexer Regelungen.
Diese Gesetze werden durch zahlreiche Verordnungen und Richtlinien konkretisiert und müssen in der jeweils aktuellen Fassung beachtet werden. Regelmäßige Updates sind essentiell, da sich die Rechtsprechung kontinuierlich entwickelt.
Zentrale Pflichten von Arbeitgebern
Fürsorgepflicht und Schutzmaßnahmen
Als Arbeitgeber tragen Sie eine umfassende Fürsorgepflicht gegenüber Ihren Beschäftigten. Diese umfasst:
- Physischer Arbeitsschutz: Gewährleistung sicherer Arbeitsplätze nach dem Arbeitsschutzgesetz
- Persönlichkeitsschutz: Schutz vor Diskriminierung, Mobbing und sexueller Belästigung
- Gesundheitsschutz: Präventive Maßnahmen und Erste-Hilfe-Ausstattung
- Datenschutz: DSGVO-konforme Verarbeitung von Mitarbeiterdaten
- Psychische Gefährdungsbeurteilung: Seit 2013 verpflichtender Schutz vor psychischen Belastungen
Praxisbeispiel: Ein Bürobetrieb muss ergonomische Arbeitsplätze bereitstellen, ausreichende Beleuchtung gewährleisten und bei Bildschirmarbeit regelmäßige Pausenregelungen einführen.
Lohn- und Arbeitszeitsregelungen
Pünktliche Lohnzahlung ist eine Ihrer wichtigsten Pflichten. Seit 2015 gilt bundesweit ein Mindestlohn (Stand 2025: 12,82 Euro/Stunde), der regelmäßig angepasst wird.
Bei der Arbeitszeit müssen Sie die gesetzlichen Grenzen strikt beachten:
- Maximal 8 Stunden täglich (ausnahmsweise bis zu 10 Stunden mit Ausgleich)
- 6-Tage-Woche mit maximal 48 Stunden/Woche im Durchschnitt von 6 Monaten
- Mindestens 11 Stunden zusammenhängende Ruhezeit zwischen den Arbeitstagen
- Pausenregelungen: 30 Minuten bei 6-9 Stunden, 45 Minuten bei über 9 Stunden Arbeit
Achtung:
Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ordnungswidrigkeit (bis zu 15.000 Euro) oder sogar als Straftat verfolgt werden. Eine ordnungsgemäße Zeiterfassung ist daher seit dem EuGH-Urteil von 2019 in Deutschland Pflicht.
Krankheitsfall: Rechte und Pflichten im Detail
Ihre Pflichten bei Krankmeldung eines Mitarbeiters
- Unverzügliche Entgegennahme der Krankmeldung dokumentieren (telefonisch, E-Mail oder persönlich)
- Lohnfortzahlung sicherstellen für die ersten 6 Wochen (100% des Gehalts gemäß § 3 EntgFG)
- AU-Bescheinigung prüfen ab dem 3. Krankheitstag (oder früher, falls vertraglich vereinbart)
- Krankenkasse informieren bei Langzeiterkrankung (Übergang zu Krankengeld nach 6 Wochen)
- BEM-Verfahren anbieten bei mehr als 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit innerhalb von 12 Monaten
Entgeltfortzahlung und Krankengeld
Die Regelungen bei Arbeitsunfähigkeit gehören zu den komplexesten Bereichen des Arbeitsrechts und haben weitreichende finanzielle Konsequenzen für Arbeitgeber.
Grundprinzip der Entgeltfortzahlung:
- Erste 6 Wochen: Arbeitgeber zahlt 100% des Lohns (§ 3 EntgFG)
- Ab 7. Woche: Krankengeld von der Krankenkasse gemäß § 44 SGB V (ca. 70% des Bruttolohns)
- Wartezeit: Anspruch erst nach 4-wöchiger Betriebszugehörigkeit
Arbeitnehmerrechte bei Krankheit
Kranke Arbeitnehmer haben spezifische Rechte, die Sie als Arbeitgeber respektieren müssen:
Meldepflichten des Arbeitnehmers:
- Unverzügliche Krankmeldung am ersten Krankheitstag gemäß § 5 EntgFG (spätestens bis Arbeitsbeginn)
- Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem 3. Tag (im Arbeitsvertrag kann 1. Tag vereinbart werden)
- Verlängerung der AU-Bescheinigung bei andauernder Krankheit rechtzeitig einreichen
Schutzrechte während der Krankheit:
- Kündigungsverbot: Keine ordentliche Kündigung während der ersten 6 Wochen der Arbeitsunfähigkeit
- Genesungsschutz: Arbeitnehmer darf genesungswidrige Tätigkeiten ablehnen
- Rekonvaleszenzurlaub: Nach längerer Krankheit Anspruch auf schrittweise Wiedereingliederung
Arbeitgeberpflichten im Krankheitsfall
Als Arbeitgeber haben Sie konkrete Verpflichtungen, wenn ein Mitarbeiter erkrankt:
Administrative Pflichten:
- Lohnfortzahlung sicherstellen: Pünktliche Zahlung des vollen Gehalts für 6 Wochen
- Krankenkasse informieren: Bei Langzeiterkrankung rechtzeitige Meldung für Krankengeld
- Arbeitsplatz reservieren: Freihaltung des Arbeitsplatzes während der Krankheit
- Dokumentation: Ordnungsgemäße Erfassung der Kranktage für Sozialversicherung
Kontroll- und Fürsorgepflichten:
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM): Bei mehr als 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit im Jahr Pflicht zur Angebotserstellung
- Arbeitsplatzanpassung: Prüfung möglicher Anpassungen zur Gesunderhaltung
- Präventionsmaßnahmen: Ergreifen von Maßnahmen zur Krankheitsvermeidung
Gut zu wissen:
Ein Arbeitgeber kann nur in Ausnahmefällen den Medizinischen Dienst (MDK) zur Überprüfung einer Arbeitsunfähigkeit einschalten. Ein allgemeiner Verdacht reicht nicht aus - es müssen konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche AU-Bescheinigung vorliegen.
Rechtliche Grenzen und Sanktionen
Was Arbeitgeber NICHT dürfen:
- Diagnose erfragen (Ausnahme: ansteckende Krankheiten)
- Kontrollanrufe während der Arbeitsunfähigkeit ohne triftigen Grund
- Kündigung allein aufgrund häufiger Krankheit (nur nach BEM-Verfahren möglich)
- Verweigerung der Lohnfortzahlung bei ordnungsgemäßer Krankmeldung
Konsequenzen bei Pflichtverletzungen:
- Nachzahlung des vorenthaltenen Lohns mit Verzugszinsen
- Bußgelder bei verspäteter Krankenkassen-Meldung
- Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers bei unrechtmäßiger Kündigung
Besondere Beschäftigungsverhältnisse
Geringfügige Beschäftigung (Mini-Jobs)
Geringfügig Beschäftigte (sogenannte Mini-Jobber) unterliegen besonderen arbeitsrechtlichen Regelungen:
Definition und Grenzen:
- Monatliches Entgelt bis maximal 520 Euro (Stand 2024)
- Oder kurzfristige Beschäftigung (max. 3 Monate oder 70 Arbeitstage pro Jahr)
- Keine Sozialversicherungspflicht (außer Rentenversicherung mit Befreiungsmöglichkeit)
Arbeitsrechtliche Besonderheiten:
- Urlaubsanspruch: Anteilig nach tatsächlicher Arbeitszeit
- Kündigungsschutz: Gilt nur bei mehr als 10 Beschäftigten (Mini-Jobber zählen anteilig)
- Lohnfortzahlung: Volles Recht auf Entgeltfortzahlung bei Krankheit (6 Wochen)
- Mindestlohn: Gilt auch für geringfügig Beschäftigte
Wichtig:
Mini-Jobber haben dieselben arbeitsrechtlichen Schutzrechte wie Vollzeitbeschäftigte. Eine Ungleichbehandlung kann zu Diskriminierungsklagen führen.
Arbeitsverträge rechtssicher gestalten
Inhaltliche Mindestanforderungen nach neuer Rechtslage
Seit der Reform des Nachweisgesetzes 2022 müssen alle wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich und vor Arbeitsaufnahme festgehalten werden. Die Änderungen gehen weit über das bisherige Recht hinaus:
Grunddaten (erweiterte Anforderungen):
- Name und Anschrift beider Vertragsparteien
- Arbeitsort oder präzise Beschreibung wechselnder Einsatzorte
- Beginn des Arbeitsverhältnisses und bei Befristung das Ende
- Neu: Tätigkeitsbeschreibung oder Berufsbezeichnung
Detaillierte Vertragskonditionen:
- Zusammensetzung und Höhe der Vergütung inklusive aller Zulagen
- Neu: Fälligkeit der Vergütung (monatlich, wöchentlich etc.)
- Arbeitszeit und deren Verteilung auf die Wochentage
- Neu: Überstundenregelungen und deren Vergütung oder Freizeitausgleich
- Urlaubsanspruch in Tagen (nicht mehr nur in Wochen)
- Kündigungsfristen für beide Vertragsparteien
Zusätzliche moderne Anforderungen:
- Homeoffice- und Mobile-Work-Regelungen
- Weiterbildungsansprüche (ab 2025 gesetzlicher Anspruch)
- Verweis auf anwendbare Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen
Befristung und Probezeit - Aktuelle Rechtsprechung
Befristete Arbeitsverträge unterliegen strengen gesetzlichen Regeln:
Mit sachlichem Grund (keine zeitliche Begrenzung):
- Vertretung erkrankter oder beurlaubter Mitarbeiter
- Projektbezogene Tätigkeiten mit festem Enddatum
- Haushaltsbudget-bedingte Befristungen im öffentlichen Dienst
Ohne sachlichen Grund (Höchstgrenzen-Regelung):
- Maximal 2 Jahre Gesamtdauer
- Bis zu 3 Verlängerungen möglich
- Wichtig: 8-Jahres-Sperrfrist bei demselben Arbeitgeber
Eine Probezeit darf maximal 6 Monate betragen und ermöglicht beidseitig verkürzte Kündigungsfristen von 2 Wochen. Bei Führungskräften sind auch längere Probezeiten bis zu 6 Monaten üblich und rechtssicher.
Praxistipp: Dokumentieren Sie Befristungsgründe präzise. Vage Formulierungen können zur Unwirksamkeit der Befristung und zur automatischen Entstehung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses führen.
Für die rechtssichere Gestaltung von Arbeitsverträgen können digitale Signaturlösungen den Prozess erheblich beschleunigen und die Nachverfolgung erleichtern.
Gut zu wissen:
Die elektronische Signatur von Arbeitsverträgen ist seit dem Bürokratieentlastungsgesetz IV vollständig rechtswirksam, wenn eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) gemäß eIDAS-Verordnung verwendet wird. Dies spart Zeit und Papier bei der Vertragsabwicklung und ermöglicht eine vollständig digitale Personalakte.
Digitalisieren Sie Ihre Arbeitsverträge rechtssicher
Kündigung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen
Ordentliche vs. außerordentliche Kündigung
Die ordentliche Kündigung erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen. Diese richten sich nach der Beschäftigungsdauer und können durch Tarifverträge verlängert werden:
Beschäftigungsdauer | Gesetzliche Kündigungsfrist (§ 622 BGB) | Gilt für |
|---|---|---|
Probezeit | 2 Wochen | Beide Seiten |
Bis 2 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder Monatsende | Beide Seiten |
Bis 5 Jahre | 1 Monat zum Monatsende | Nur Arbeitgeber |
Bis 8 Jahre | 2 Monate zum Monatsende | Nur Arbeitgeber |
Bis 12 Jahre | 3 Monate zum Monatsende | Nur Arbeitgeber |
Bis 15 Jahre | 4 Monate zum Monatsende | Nur Arbeitgeber |
Über 20 Jahre | 7 Monate zum Monatsende | Nur Arbeitgeber |
Die außerordentliche (fristlose) Kündigung ist nur bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen möglich und muss innerhalb von 2 Wochen nach Kenntniserlangung des Kündigungsgrunds erfolgen.
Beispiele fristloser Kündigungsgründe:
- Diebstahl, Betrug oder Untreue
- Schwerwiegende Beleidigung von Vorgesetzten oder Kollegen
- Beharrliche Arbeitsverweigerung
- Konkurrenztätigkeit ohne Erlaubnis
Kündigungsschutz nach aktueller Rechtsprechung
Das Kündigungsschutzgesetz greift bei:
- Mehr als 10 Beschäftigten im Betrieb (Teilzeitkräfte werden anteilig gerechnet)
- Mindestens 6 Monate ununterbrochener Betriebszugehörigkeit
Dann ist eine Kündigung nur mit sozial gerechtfertigtem Grund möglich:
Personenbedingte Kündigung:
- Dauerhafte Arbeitsunfähigkeit ohne Besserungsaussicht
- Fehlende behördliche Erlaubnis (z.B. Führerscheinentzug bei Berufskraftfahrern)
- Häufige Kurzerkrankungen nach erfolglosem BEM-Verfahren
Verhaltensbedingte Kündigung:
- Wiederholte, erhebliche Pflichtverletzungen trotz Abmahnung
- Schwerwiegende Verstöße gegen betriebliche Ordnung
- Vertrauensbruch durch Straftaten im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis
Betriebsbedingte Kündigung:
- Wegfall des Arbeitsplatzes durch wirtschaftliche oder technische Gründe
- Betriebsschließung oder erhebliche Betriebseinschränkung
- Outsourcing von Unternehmensbereichen
Bei betriebsbedingten Kündigungen ist eine Sozialauswahl nach folgenden Kriterien vorzunehmen:
- Lebensalter (höheres Alter = größerer Schutz)
- Betriebszugehörigkeit (längere Dauer = größerer Schutz)
- Unterhaltspflichten für Familie
- Schwerbehinderung
Wichtig:
Eine fehlerhafte Kündigung kann zur Weiterbeschäftigungspflicht und erheblichen Nachzahlungen führen. Bei Unsicherheiten sollten Sie arbeitsrechtliche Beratung in Anspruch nehmen. Ein Fachanwalt für Arbeitsrecht kann Sie bei komplexen Kündigungsfällen beraten.
Praktische Tipps für die rechtssichere Personalführung
Digitalisierung von HR-Prozessen nutzen: Moderne HR-Software hilft bei der Einhaltung von Dokumentationspflichten und Fristen. Automatisierte Erinnerungen für Probezeit-Enden oder Befristungen reduzieren rechtliche Risiken.
Systematische Mitarbeitergespräche: Führen Sie regelmäßige Feedbackgespräche und dokumentieren Sie diese. Dies hilft bei späteren arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen und zeigt Ihre Fürsorgepflicht.
Gleichbehandlung strukturell sicherstellen: Entwickeln Sie klare Richtlinien für Gehaltsstrukturen, Urlaubsgenehmigungen und Personalentscheidungen. Willkürliche Unterscheidungen können kostspielige Diskriminierungsklagen nach sich ziehen.
Weiterbildung als Investment: Investieren Sie in regelmäßige arbeitsrechtliche Schulungen für Führungskräfte. Die Rechtsprechung entwickelt sich kontinuierlich weiter, und gut geschulte Manager vermeiden teure Fehler.
Betriebsrat als Partner verstehen: Falls ein Betriebsrat existiert, pflegen Sie eine konstruktive Zusammenarbeit. Viele Konflikte lassen sich durch frühzeitige Kommunikation und Einbeziehung vermeiden.
Fazit
Das deutsche Arbeitsrecht ist komplex, aber mit systematischem Vorgehen beherrschbar. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Krankheits-Regelungen, da hier täglich Entscheidungen getroffen werden müssen. Mit fundierten Grundkenntnissen, einer durchdachten Digitalisierungsstrategie und professioneller Beratung bei kritischen Fällen können Sie rechtssichere Arbeitsverhältnisse gestalten und gleichzeitig ein motivierendes Arbeitsklima schaffen.
Vereinfachen Sie Ihre HR-Prozesse mit digitalen Lösungen
Moderne Personalabteilungen setzen auf digitale Workflows für Arbeitsverträge, Kündigungen und andere wichtige Dokumente. Yousign bietet Ihnen:
- Rechtssichere elektronische Signatur für alle HR-Dokumente
- Automatisierte Erinnerungen und Nachverfolgung von Vertragsfristen
- DSGVO-konforme Speicherung und Archivierung
- Nahtlose Integration in Ihre bestehenden HR-Systeme
- Qualifizierte elektronische Signatur (QES) für alle Arbeitsverträge
Testen Sie die elektronische Signatur 14 Tage lang kostenlos
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind die wichtigsten arbeitsrechtlichen Pflichten für Arbeitgeber?
Die zentralen Pflichten umfassen die Fürsorgepflicht, pünktliche Lohnzahlung, Einhaltung von Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie die Gewährleistung sicherer Arbeitsplätze nach dem Arbeitsschutzgesetz.
Wie lange muss ich als Arbeitgeber bei Krankheit das Gehalt weiterzahlen?
Sie müssen für die ersten 6 Wochen einer jeden Arbeitsunfähigkeit 100% des Lohns weiterzahlen. Anschließend übernimmt die Krankenkasse mit dem Krankengeld (etwa 70% des Bruttolohns). Bei derselben Krankheit innerhalb von 12 Monaten entfällt die erneute Lohnfortzahlungspflicht.
Darf ich einen kranken Mitarbeiter kündigen?
Eine Kündigung allein wegen Krankheit ist während der ersten 6 Wochen der Arbeitsunfähigkeit nicht möglich. Bei häufigen oder langandauernden Erkrankungen ist zunächst ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten. Nur nach erfolglosem BEM kann eine personenbedingte Kündigung erwogen werden.
Wann greift das Kündigungsschutzgesetz?
Das KSchG gilt bei mehr als 10 Beschäftigten im Betrieb und mindestens 6 Monaten Betriebszugehörigkeit des Mitarbeiters. Dann sind Kündigungen nur mit sozial gerechtfertigtem Grund möglich (personen-, verhaltens- oder betriebsbedingt).
Müssen Arbeitsverträge schriftlich abgeschlossen werden?
Ja, seit der Reform des Nachweisgesetzes 2022 müssen alle wesentlichen Arbeitsbedingungen vor Arbeitsaufnahme schriftlich dokumentiert und dem Arbeitnehmer ausgehändigt werden. Elektronische Verträge mit qualifizierter Signatur sind rechtlich gleichwertig.
Wann muss ein Mitarbeiter eine Krankmeldung einreichen?
Die Krankmeldung muss unverzüglich, spätestens zu Arbeitsbeginn am ersten Krankheitstag erfolgen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist ab dem 3. Tag erforderlich (kann vertraglich auf den 1. Tag verkürzt werden). Bei Verlängerung muss die neue AU-Bescheinigung nahtlos anschließen.