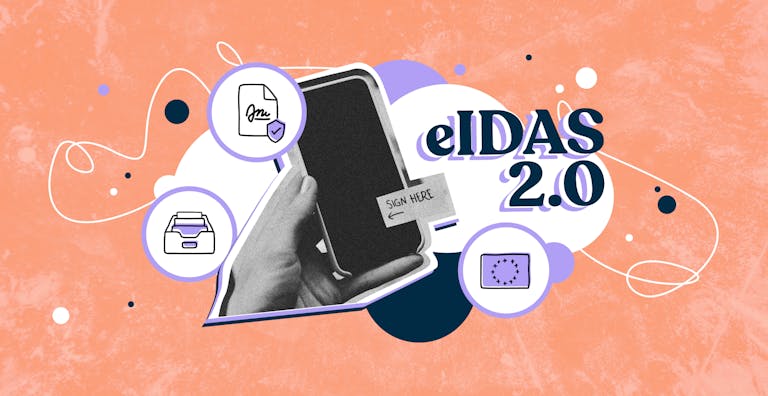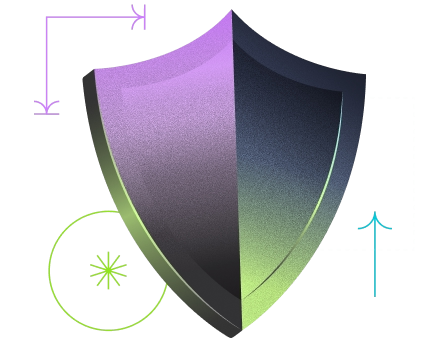Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) markiert einen Wendepunkt für Unternehmen in der Europäischen Union. Mit strengeren Transparenzanforderungen und erweiterten Berichtspflichten verändert diese Richtlinie grundlegend, wie Organisationen ihre Nachhaltigkeitsleistungen kommunizieren müssen. Für Geschäftsführer, CFOs und Compliance-Verantwortliche bedeutet dies: Die Zeit des freiwilligen Reportings ist vorbei.
Die CSRD tritt schrittweise ab dem Geschäftsjahr 2024 in Kraft und betrifft deutlich mehr Unternehmen als die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Schätzungen zufolge müssen künftig rund 50.000 Unternehmen in der EU über ihre ESG-Performance (Environmental, Social, Governance) berichten – eine Verzehnfachung gegenüber den bisherigen 11.000 berichtspflichtigen Organisationen. Diese Entwicklung stellt Unternehmen vor erhebliche operative und strategische Herausforderungen, bietet aber gleichzeitig die Chance, Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil zu etablieren.
In diesem Artikel erfahren Sie, was die CSRD konkret fordert, wie sie sich von anderen Regulierungen unterscheidet und welche Schritte Ihr Unternehmen zur erfolgreichen Umsetzung unternehmen sollte.
Zusammenfassung in Kürze:
- CSRD-Definition: Die Corporate Sustainability Reporting Directive ist eine EU-Richtlinie, die Unternehmen verpflichtet, detaillierte Nachhaltigkeitsberichte nach einheitlichen Standards (ESRS) zu erstellen.
- Anwendungsbereich: Ab 2024 schrittweise Einführung für große Unternehmen, kapitalmarktorientierte KMU und bestimmte Nicht-EU-Unternehmen mit Niederlassungen in Europa.
- Unterschied zur EU-Taxonomie: Während die CSRD über alle ESG-Aspekte berichtet, klassifiziert die EU-Taxonomie, welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig gelten.
- Compliance-Vorteile: Frühzeitige Umsetzung verbessert Stakeholder-Vertrauen, reduziert regulatorische Risiken und stärkt die Wettbewerbsposition.
- EMAS-Synergien: Unternehmen mit etablierten Umweltmanagementsystemen wie EMAS profitieren von kürzeren Implementierungszeiten und strukturierten Prozessen.
Überblick über die CSRD und ihre Ziele
Was ist die CSRD?
Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ist eine europäische Richtlinie, die am 5. Januar 2023 in Kraft getreten ist und die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ersetzt und erweitert. Sie verpflichtet Unternehmen zur transparenten Berichterstattung über ihre Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung.
Die CSRD basiert auf dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit (Double Materiality): Unternehmen müssen sowohl berichten, wie Nachhaltigkeitsthemen ihr Geschäft beeinflussen (Outside-in-Perspektive), als auch welche Auswirkungen ihre Tätigkeiten auf Umwelt und Gesellschaft haben (Inside-out-Perspektive).
Die CSRD schafft ein neues Level an Transparenz und Vergleichbarkeit in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und macht ESG-Daten so relevant wie Finanzdaten.
Die Richtlinie führt verbindliche European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ein, die von der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) entwickelt wurden. Diese Standards umfassen zwölf thematische Bereiche, darunter Klimawandel, Biodiversität, eigene Belegschaft und Geschäftsethik.
Ziele der CSRD
Verbesserung der Transparenz
Das zentrale Ziel der CSRD ist die Schaffung vergleichbarer, zuverlässiger und standardisierter Nachhaltigkeitsinformationen. Investoren, Kunden und andere Stakeholder sollen fundierte Entscheidungen treffen können, basierend auf konsistenten ESG-Daten.
Die CSRD fordert die digitale Berichterstattung im European Single Electronic Format (ESEF), was maschinelle Lesbarkeit und automatisierte Analysen ermöglicht. Zudem müssen die Berichte von unabhängigen Prüfern mit begrenzter Sicherheit (Limited Assurance) verifiziert werden – mit der Perspektive, in Zukunft auf hinreichende Sicherheit (Reasonable Assurance) überzugehen.
Durch diese Anforderungen wird "Greenwashing" – das Vortäuschen von Nachhaltigkeit ohne echte Maßnahmen – deutlich erschwert. Unternehmen können nicht länger mit vagen Nachhaltigkeitsversprechen operieren, sondern müssen konkrete Daten, Ziele und Fortschritte offenlegen.
Förderung nachhaltiger Praktiken
Die CSRD ist nicht nur ein Reporting-Instrument, sondern ein Hebel zur Transformation. Indem Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsleistung systematisch erfassen und veröffentlichen müssen, entsteht ein starker Anreiz, ESG-Risiken zu managen und Chancen zu nutzen.
Die Richtlinie fördert:
- Langfristige Strategien: Unternehmen müssen ihre Nachhaltigkeitsziele und Maßnahmenpläne darlegen.
- Stakeholder-Engagement: Die Einbindung von Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten wird zum integralen Bestandteil der Berichterstattung.
- Innovation: Die Offenlegung von Klimarisiken und Ressourcenverbräuchen treibt Investitionen in grüne Technologien voran.
- Zugang zu Kapital: Nachhaltige Unternehmen profitieren von besseren Finanzierungsbedingungen und steigendem Interesse institutioneller Investoren.
Zusammenhang zur EU-Taxonomie
Die CSRD und die EU-Taxonomie-Verordnung sind zwei komplementäre Regulierungen, die gemeinsam ein kohärentes Rahmenwerk für nachhaltiges Wirtschaften bilden.
Die EU-Taxonomie definiert wissenschaftsbasierte Kriterien, nach denen Wirtschaftsaktivitäten als ökologisch nachhaltig klassifiziert werden. Sie beantwortet die Frage: "Ist diese Geschäftstätigkeit grün?" Die CSRD hingegen fordert die transparente Berichterstattung über alle wesentlichen ESG-Aspekte – unabhängig davon, ob diese als nachhaltig eingestuft werden oder nicht.
Im Rahmen der CSRD müssen Unternehmen angeben, welcher Anteil ihres Umsatzes, ihrer Investitionen (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) auf taxonomiekonforme Aktivitäten entfällt. Diese Verzahnung macht deutlich: Die CSRD ist das Berichtsinstrument, die Taxonomie liefert die Klassifikationslogik.
Gut zu wissen:
Unternehmen, die bereits nach der EU-Taxonomie berichten, haben einen Vorsprung bei der CSRD-Implementierung, da wesentliche Datenstrukturen und Prozesse bereits etabliert sind.
Unterschiede zwischen CSRD und EU-Taxonomie
Definition der EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie-Verordnung (Regulation (EU) 2020/852) ist ein Klassifikationssystem, das festlegt, welche Wirtschaftsaktivitäten als ökologisch nachhaltig gelten. Sie definiert sechs Umweltziele:
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
Eine Aktivität gilt als taxonomiekonform, wenn sie:
- Wesentlich zu mindestens einem der sechs Umweltziele beiträgt
- Keines der anderen Ziele erheblich beeinträchtigt (Do No Significant Harm - DNSH)
- Soziale Mindeststandards einhält
- Die technischen Bewertungskriterien erfüllt
Vergleich der Anforderungen
Berichterstattungspflichten
Die CSRD fordert eine umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den ESRS-Standards, die weit über reine Umweltaspekte hinausgehen. Unternehmen müssen über folgende Dimensionen berichten:
- Umwelt (E): Klimawandel, Verschmutzung, Wasser, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft
- Soziales (S): Eigene Belegschaft, Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette, betroffene Gemeinschaften, Verbraucher
- Governance (G): Unternehmensführung, Geschäftsethik
Die EU-Taxonomie hingegen konzentriert sich ausschließlich auf die ökologische Nachhaltigkeit von Wirtschaftsaktivitäten. Unternehmen müssen quantitativ angeben, welcher Anteil ihrer Geschäftstätigkeit taxonomiekonform ist.
Kriterium | CSRD | EU-Taxonomie |
|---|---|---|
Fokus | Umfassende ESG-Berichterstattung | Klassifikation grüner Aktivitäten |
Standards | ESRS (12 thematische Standards) | Technische Screening-Kriterien |
Berichtsformat | Qualitativ & quantitativ | Primär quantitativ (%, KPIs) |
Prüfpflicht | Ja (Limited/Reasonable Assurance) | Nein (aber durch CSRD-Prüfung abgedeckt) |
Scope | Alle wesentlichen ESG-Themen | 6 Umweltziele |
Anwendungsbereich
Die CSRD weitet den Kreis berichtspflichtiger Unternehmen erheblich aus:
- Große Unternehmen: Alle großen Unternehmen, die zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 40 Mio. € Nettoumsatz oder mehr als 20 Mio. € Bilanzsumme
- Kapitalmarktorientierte KMU: Ab 2026 (mit Opt-out-Möglichkeit bis 2028)
Die EU-Taxonomie gilt für dieselben Unternehmen, die auch nach CSRD berichten müssen, sowie für Finanzmarktteilnehmer. Der Kreis ist also identisch, aber die Taxonomie verlangt spezifische Offenlegungen zur grünen Klassifikation.
Wichtig:
KMU, die nicht berichtspflichtig sind, können freiwillig nach CSRD berichten, um ihre Attraktivität für Investoren und Geschäftspartner zu steigern.
Umsetzung der CSRD innerhalb der EU
Die CSRD muss von allen EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Der Zeitplan:
- 2024: Große börsennotierte Unternehmen, die bereits nach NFRD berichtspflichtig waren
- 2025: Alle großen Unternehmen (unabhängig von Börsennotierung)
- 2026: Kapitalmarktorientierte KMU, kleine Banken und Versicherungen
- 2028: Nicht-EU-Unternehmen mit EU-Niederlassungen
Die Europäische Kommission überwacht die Umsetzung und kann delegierte Rechtsakte erlassen, um die ESRS an technische und wissenschaftliche Entwicklungen anzupassen. Eine erste Überprüfung der ESRS ist für 2026 geplant.
Schritte zur Einhaltung der CSRD für Unternehmen
Anforderungen an die Berichterstattung
Die CSRD-Compliance erfordert eine systematische Herangehensweise. Unternehmen müssen folgende Kernelemente erfüllen:
1. Doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchführen
Identifizieren Sie, welche Nachhaltigkeitsthemen für Ihr Unternehmen und Ihre Stakeholder wesentlich sind – sowohl aus finanzieller Perspektive (Outside-in) als auch aus Wirkungsperspektive (Inside-out).
2. Nachhaltigkeitsbericht nach ESRS erstellen
Der Bericht muss strukturiert sein gemäß den zwölf thematischen ESRS-Standards. Er umfasst:
- Governance-Strukturen für Nachhaltigkeit
- Strategie und Geschäftsmodell
- Risiken und Chancen
- Ziele und Leistungsindikatoren
- Maßnahmenpläne
3. Digitale Berichterstattung im ESEF-Format
Die Nachhaltigkeitsinformationen müssen im European Single Electronic Format bereitgestellt werden, was maschinelle Lesbarkeit ermöglicht.
4. Externe Prüfung sicherstellen
Der Nachhaltigkeitsbericht muss von einem unabhängigen Prüfer mit begrenzter Sicherheit verifiziert werden. Perspektivisch ist eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit vorgesehen.
5. Integration in den Lagebericht
Nachhaltigkeitsinformationen werden Teil des Lageberichts und damit gleichwertig mit Finanzinformationen behandelt.
Implementierung eines effektiven Reporting-Systems
Sammlung relevanter Daten
Die Datenerfassung ist das Rückgrat der CSRD-Compliance. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass ESG-Daten bislang dezentral, inkonsistent oder gar nicht erfasst wurden.
Empfohlene Schritte:
- Gap-Analyse: Vergleichen Sie bestehende Datenquellen mit CSRD-Anforderungen und identifizieren Sie Lücken.
- Datenmanagementsystem implementieren: Nutzen Sie spezialisierte ESG-Software oder erweitern Sie bestehende ERP-Systeme um Nachhaltigkeitsmodule.
- Datenqualität sichern: Etablieren Sie Validierungsprozesse, um Fehler und Inkonsistenzen zu minimieren.
- Automatisierung nutzen: Digitale Lösungen wie elektronische Signaturen können Prozesse beschleunigen und Papierdokumentation reduzieren – ein Beitrag zur eigenen Nachhaltigkeitsbilanz.
Praxisbeispiel: Ein mittelständisches Produktionsunternehmen implementierte ein zentrales ESG-Dashboard, das Energieverbrauch, Emissionen und soziale KPIs in Echtzeit erfasst. Die Integration mit dem bestehenden ERP-System reduzierte den manuellen Aufwand um 60 % und verbesserte die Datenqualität erheblich.
Einbeziehung der Stakeholder
Die CSRD fordert explizit die Berücksichtigung von Stakeholder-Interessen. Dies umfasst:
- Mitarbeitende: Befragungen zu Arbeitsbedingungen, Weiterbildung und Diversität
- Lieferanten: Bewertung sozialer und ökologischer Standards in der Lieferkette
- Kunden: Feedback zu Produktnachhaltigkeit und Transparenz
- Investoren: Dialog über ESG-Strategie und Risikomanagement
- Lokale Gemeinschaften: Austausch über Umweltauswirkungen und soziales Engagement
Ein strukturierter Stakeholder-Dialog liefert nicht nur wertvolle Daten für die Berichterstattung, sondern stärkt auch das Vertrauen und identifiziert Verbesserungspotenziale.
Ressourcen für Unternehmen auf dem Weg zur Compliance
Die CSRD-Umsetzung erfordert Investitionen in Personal, Technologie und Prozesse. Folgende Ressourcen und Maßnahmen unterstützen den Compliance-Prozess:
Interne Ressourcen:
- Aufbau eines interdisziplinären ESG-Teams (Finanzen, Operations, HR, Legal)
- Schulungen für Mitarbeitende zu ESRS-Standards und Datenerfassung
- Einrichtung einer Governance-Struktur mit klaren Verantwortlichkeiten
Externe Unterstützung:
- Beratung durch spezialisierte Nachhaltigkeitsberater
- Technologieanbieter für ESG-Software und Datenanalyse
- Wirtschaftsprüfer für die externe Assurance-Leistung
Öffentliche Förderprogramme: In Deutschland und anderen EU-Ländern stehen Fördermittel zur Verfügung, um insbesondere KMU bei der digitalen und nachhaltigen Transformation zu unterstützen. Informieren Sie sich bei Ihrer IHK oder nationalen Förderinstitutionen.
Achtung:
Die CSRD-Umsetzung ist keine einmalige Übung, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Planen Sie ausreichend Zeit für die Erstimplementierung ein.
Bedeutung von Umweltmanagementsystemen wie EMAS
Rolle von EMAS in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ist das europäische Umweltmanagementsystem, das Unternehmen dabei hilft, ihre Umweltleistung systematisch zu verbessern und transparent zu kommunizieren. EMAS wurde bereits 1993 eingeführt und ist besonders in Deutschland weit verbreitet.
Unternehmen mit EMAS-Zertifizierung haben einen klaren Vorteil bei der CSRD-Umsetzung:
- Strukturierte Datenerfassung: EMAS erfordert bereits die systematische Erfassung von Umweltkennzahlen (Energie, Emissionen, Wasser, Abfall), die für die CSRD relevant sind.
- Externe Validierung: EMAS-Umwelterklärungen werden von unabhängigen Umweltgutachtern geprüft – eine Vorbereitung auf die CSRD-Prüfpflicht.
- Stakeholder-Kommunikation: Die EMAS-Umwelterklärung ist öffentlich zugänglich und erfüllt bereits Transparenzanforderungen.
- Kontinuierliche Verbesserung: EMAS basiert auf dem PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act), der auch für die CSRD-Strategieentwicklung wertvoll ist.
Während EMAS sich auf Umweltaspekte konzentriert, deckt die CSRD ein breiteres Spektrum ab (E, S und G). EMAS-Unternehmen müssen also zusätzlich soziale und Governance-Dimensionen integrieren, profitieren aber von etablierten Prozessen und einer Compliance-Kultur.
Vorteile eines EMAS-Systems für Unternehmen
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
EMAS-zertifizierte Unternehmen positionieren sich als Nachhaltigkeitsführer. Dies bringt konkrete Geschäftsvorteile:
- Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen: Viele Vergabestellen bevorzugen oder fordern EMAS-Zertifizierungen.
- Lieferantenauswahl: Große Konzerne integrieren EMAS zunehmend in ihre Lieferantenbewertung.
- Kostenreduktion: Systematisches Umweltmanagement senkt Energie- und Ressourcenkosten – EMAS-zertifizierte Unternehmen berichten von signifikanten Einsparungen bei Energie- und Ressourcenkosten
- Risikominimierung: Proaktives Management von Umweltrisiken reduziert Haftungsrisiken und regulatorische Bußgelder.
Verbesserung des Unternehmensimages
Transparenz und Glaubwürdigkeit sind in Zeiten von Greenwashing-Vorwürfen entscheidend. EMAS bietet:
- Glaubwürdiges Nachhaltigkeitslabel: Die EMAS-Registrierung ist EU-weit anerkannt und signalisiert ernsthaftes Engagement.
- Mitarbeitermotivation: Studien zeigen, dass Beschäftigte stolz auf EMAS-zertifizierte Arbeitgeber sind und sich stärker mit dem Unternehmen identifizieren.
- Kundenvertrauen: Besonders im B2C-Bereich schätzen Endverbraucher nachweislich nachhaltige Unternehmen.
- Investorenattraktivität: ESG-orientierte Investoren bewerten EMAS als positives Signal für Risikomanagement und Zukunftsfähigkeit.
EMAS und die CSRD-Vorgaben
Die Verbindung zwischen EMAS und CSRD wird durch die EU strategisch gestärkt. Die Europäische Kommission betont, dass EMAS-Unternehmen als Vorreiter der CSRD-Umsetzung fungieren können.
Synergien nutzen:
- E-Teil der CSRD: EMAS deckt bereits wesentliche Teile der umweltbezogenen ESRS-Standards ab (Klimawandel, Ressourcennutzung, Verschmutzung).
- S- und G-Ergänzung: Erweitern Sie Ihr EMAS um soziale und Governance-Aspekte, um CSRD-konform zu werden.
- Integrierte Berichterstattung: Die EMAS-Umwelterklärung kann als Basis für Teile des CSRD-Nachhaltigkeitsberichts dienen.
Zu beachten:
EMAS ersetzt nicht die CSRD-Berichterstattung, erleichtert aber die Umsetzung erheblich und kann in Zukunft möglicherweise zu vereinfachten Prüfverfahren führen.
Fazit und Ausblick
Zukünftige Trends in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Die CSRD ist nur der Anfang einer tiefgreifenden Transformation. Mehrere Trends zeichnen sich ab:
1. Zunehmende Digitalisierung und Automatisierung
ESG-Daten werden zunehmend in Echtzeit erfasst und über APIs mit Stakeholder-Plattformen verbunden. Künstliche Intelligenz unterstützt bei der Datenanalyse und Trendprognose.
2. Verknüpfung mit Finanzberichterstattung
Die Trennung zwischen Finanz- und Nachhaltigkeitsinformationen wird weiter aufgehoben. Integriertes Reporting wird zum Standard.
3. Lieferketten-Transparenz
Die CSRD fordert Berichterstattung über die gesamte Wertschöpfungskette. Unternehmen müssen Daten von Lieferanten systematisch erfassen – ein enormer Datenbeschaffungsaufwand.
4. Internationale Harmonisierung
Die ESRS sind mit den Standards der International Sustainability Standards Board (ISSB) weitgehend kompatibel, was globalen Unternehmen die Berichterstattung erleichtert.
5. Verstärkte Prüfungsanforderungen
Der Übergang von Limited Assurance zu Reasonable Assurance wird die Anforderungen an Datenqualität und interne Kontrollen weiter erhöhen.
Ermutigung zur proaktiven Anpassung
Chancen für KMU
Auch wenn die CSRD zunächst für große Unternehmen gilt, sollten KMU die Entwicklung nicht ignorieren. Viele sind indirekt betroffen, da sie Teil der Lieferketten berichtspflichtiger Unternehmen sind.
Handlungsempfehlungen für KMU:
- Beginnen Sie frühzeitig mit der systematischen Erfassung von ESG-Daten
- Nutzen Sie vereinfachte ESRS-Standards für KMU, sobald diese verfügbar sind
- Positionieren Sie Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil gegenüber Großkunden
- Erwägen Sie EMAS-Zertifizierung als strukturierten Einstieg
Wachsende Bedeutung des CSR
Corporate Social Responsibility (CSR) entwickelt sich vom Marketinginstrument zur Geschäftsstrategie. Die CSRD macht deutlich: Nachhaltigkeit ist nicht mehr optional, sondern regulatorisch gefordert und ökonomisch sinnvoll.
Unternehmen, die CSR ernst nehmen, profitieren von:
- Zugang zu Kapital: Nachhaltige Finanzprodukte boomen, und institutionelle Investoren priorisieren ESG-Leader.
- Talentgewinnung: Die Generation Z legt großen Wert auf die Nachhaltigkeitsbilanz ihres Arbeitgebers.
- Resilienz: Unternehmen mit starkem ESG-Profil sind widerstandsfähiger gegenüber Regulierungsänderungen und Reputationsrisiken.
- Innovation: Der Zwang zur Transformation treibt neue Geschäftsmodelle und Technologien voran.
Nachhaltige Prozesse mit Yousign umsetzen
Die CSRD fordert nicht nur Transparenz, sondern auch konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Digitale Dokumentenprozesse spielen dabei eine wichtige Rolle.
Yousign unterstützt Unternehmen dabei, ihre Vertragsprozesse nachhaltig zu gestalten:
- Papierlose Workflows: Reduzieren Sie Druckkosten, Papierverbrauch und CO₂-Emissionen durch Transport.
- Rechtssichere elektronische Signaturen: Alle Signaturlevel (einfach, fortgeschritten, qualifiziert) konform mit eIDAS-Verordnung.
- Effizienzsteigerung: Vertragsprozesse werden um durchschnittlich 70 % beschleunigt, was Ressourcen für strategische Nachhaltigkeitsinitiativen freisetzt.
- Transparente Dokumentation: Lückenlose Audit-Trails unterstützen Ihre CSRD-Berichterstattung.
Mit Yousign machen Sie Ihre Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch nachweislich nachhaltiger – ein konkreter Beitrag zu Ihrer ESG-Strategie.
Jetzt Yousign kostenlos testen
FAQ
Wer ist von der CSRD betroffen?
Die CSRD gilt ab 2024 schrittweise für große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, kapitalmarktorientierte KMU ab 2026 und Nicht-EU-Unternehmen mit EU-Niederlassungen ab 2028. Insgesamt sind rund 50.000 Unternehmen in der EU betroffen.
Was ist der Unterschied zwischen CSRD und EU-Taxonomie?
Die CSRD fordert umfassende Berichterstattung über alle wesentlichen ESG-Aspekte, während die EU-Taxonomie ein Klassifikationssystem ist, das definiert, welche Wirtschaftsaktivitäten als ökologisch nachhaltig gelten. Die Taxonomie-Konformität muss im Rahmen der CSRD-Berichterstattung offengelegt werden.
Welche Standards gelten für die CSRD-Berichterstattung?
Unternehmen müssen nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) berichten, die von der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) entwickelt wurden. Es gibt zwölf thematische Standards zu Umwelt, Sozialem und Governance.
Müssen KMU nach CSRD berichten?
Kapitalmarktorientierte KMU sind ab 2026 berichtspflichtig, können aber eine Opt-out-Option bis 2028 nutzen. Nicht-kapitalmarktorientierte KMU sind grundsätzlich nicht verpflichtet, können aber freiwillig berichten. Viele KMU sind jedoch indirekt betroffen, da sie Zulieferer berichtspflichtiger Unternehmen sind.
Wie unterstützt EMAS die CSRD-Umsetzung?
EMAS-zertifizierte Unternehmen haben bereits strukturierte Prozesse zur Umweltdatenerfassung und externe Validierung etabliert. Dies erleichtert die CSRD-Compliance erheblich, da wesentliche Umweltaspekte bereits abgedeckt sind. Soziale und Governance-Dimensionen müssen ergänzt werden.
Gibt es Sanktionen bei Nicht-Compliance?
Ja. Die CSRD wird in nationales Recht umgesetzt, und die Mitgliedstaaten legen Sanktionen fest. Diese können Bußgelder, Veröffentlichungspflichten von Verstößen und im Extremfall auch Marktausschlüsse umfassen. Zudem drohen Reputationsschäden und Vertrauensverlust bei Investoren.